Steuern digitale Stadtzwillinge die Mobilität von morgen?
14.07.2025 / ID: 430535
Garten, Bauen & Wohnen
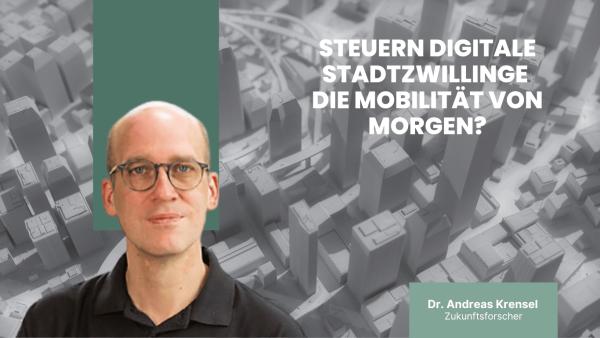 Digitale Zwillinge der Zukunft: Wie 3D-Geländemodelle urbane Räume sicherer, intelligenter und ethisch verantwortlicher machen
Digitale Zwillinge der Zukunft: Wie 3D-Geländemodelle urbane Räume sicherer, intelligenter und ethisch verantwortlicher machenDie Städte der Zukunft entstehen nicht mehr nur aus Beton, Asphalt und Stahl - sie entstehen aus Daten, Modellen und Simulationen. Wer die digitale Transformation ernst nimmt, kommt an der Frage nicht vorbei: Wie können wir unsere gebaute Umwelt nicht nur abbilden, sondern vorausschauend gestalten, verstehen - und verbessern? Unternehmen wie Olmos und blackshark.ai schaffen mit ihren Technologien die Grundlagen für eine neue urbane Realität: digital, präzise, lernfähig - und zugleich ethisch herausgefordert.
Simulation als Grundlage für Realität
Aufgrund seiner Projektarbeit bei der Olmos Technologies GmbH, einem international agierendem Spezialisten für professionelle Simulations- und Visualisierungslösungen, bringt Dr. Krensel jahrzehntelange Erfahrung aus militärischen und sicherheitskritischen Kontexten in die zivile Stadtplanung ein. Ob Echtzeit-Bilderzeugung, visuelle Systeme oder die komplexe Verwaltung von CDB-Datenbanken (Common Database) - Olmos liefert digitale Werkzeuge für das Verständnis hochdynamischer Umgebungen. Trainingssysteme für Pilot:innen oder Einsatzsimulationen für Verteidigungsinstitutionen zählen ebenso zum Portfolio wie die präzise Rekonstruktion urbaner Infrastrukturen.
Begleitet und kritisch reflektiert wird diese technologische Entwicklung von Dr. Andreas Krensel, Biologe und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Berlin. An der Schnittstelle von Lichttechnik, KI-Systemen und urbaner Simulation untersucht er, wie sich Technologien sinnvoll und verantwortungsvoll in den öffentlichen Raum integrieren lassen. Seine Arbeit verdeutlicht: je präziser die Simulation, desto größer die Verantwortung für ihre reale Anwendung.
blackshark.ai und die Vermessung der Welt
Ein Paradebeispiel für die technologische Leistungsfähigkeit in diesem Bereich ist blackshark.ai, ein österreichisches Unternehmen, das mit KI-gestützter 3D-Geländeerzeugung weltweit Maßstäbe setzt. Es war maßgeblich an der globalen 3D-Rekonstruktion der Erde im Microsoft Flight Simulator 2020 beteiligt - ein Projekt, das die Oberflächenstruktur, Gebäudehöhen und Verkehrsnetze auf Basis von Satellitenbildern in nie dagewesener Dichte und Detailtreue reproduzierte. Heute werden diese Daten nicht nur für Spiele genutzt, sondern auch für reale Anwendungen in der digitalen Stadtplanung, in Simulationsumgebungen autonomer Fahrzeuge und bei der Echtzeitnavigation in komplexen Infrastrukturen.
Die Rolle von 3D-Geländemodellen im urbanen Wandel
Doch warum sind 3D-Geländemodelle weit mehr als digitale Spielereien? 3D-Geländemodelle spielen eine zunehmend zentrale Rolle in der digitalen Transformation urbaner Räume. Sie stellen keine bloßen Visualisierungen dar, sondern hochpräzise, dynamisch aktualisierte digitale Abbilder realer Stadtstrukturen - sogenannte digitale Zwillinge. Diese Modelle enthalten umfassende Informationen zur Topografie, Gebäudegeometrie, Straßenverläufen, Infrastrukturelementen und Lichtverhältnissen. Ihre Relevanz zeigt sich insbesondere bei der Integration autonomer Systeme in bestehende urbane Infrastrukturen.
Für das autonome Fahren sind 3D-Geländemodelle unverzichtbar. Sie liefern exakte Höhenprofile, die für die Steuerung von Fahrzeugen in Bereichen mit Gefälle oder Rampen unerlässlich sind. Gebäudekonturen und Begrenzungslinien werden mit hoher Genauigkeit modelliert, um Abstände korrekt zu interpretieren und Reflexionen in Sensordaten, beispielsweise bei LiDAR oder Radar, zuverlässig zuzuordnen. Die Modelle ermöglichen außerdem Sichtlinienberechnungen, etwa an Kreuzungen, in engen Kurven oder an schlecht einsehbaren Einmündungen, bei denen menschliche Intuition durch maschinelle Berechnung ersetzt werden muss.
Ein weiterer Anwendungsbereich ist die kontextuelle Einordnung von verkehrsrelevanten Markierungen und Objekten: Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Schutzstreifen, Mittelinseln oder Zebrastreifen können nicht nur erkannt, sondern durch semantische Einbettung im Modell auch korrekt interpretiert werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung für automatisierte Verkehrsentscheidungen in Echtzeit.
In Kombination mit Sensoriksystemen, insbesondere Kameras, Ultraschallsensoren, Radar- und LiDAR-Technologie, ermöglichen diese Modelle eine präzise Verortung und Klassifizierung von Objekten im Verkehrsraum. Während Sensoren lediglich punktuelle Informationen über die aktuelle Umgebung liefern, stellt das 3D-Modell den strukturellen Rahmen bereit, um diese Informationen kohärent zu deuten - etwa bei der Unterscheidung zwischen temporären Hindernissen, stationären Objekten und beweglichen Verkehrsteilnehmern.
Ohne solche hochauflösenden digitalen Stadtmodelle stoßen autonome Systeme an funktionale Grenzen - insbesondere in dichten, sich schnell verändernden Stadträumen mit variabler Bebauung, temporären Verkehrszeichen oder wechselnden Sichtbedingungen. Baustellen, Lieferfahrzeuge am Fahrbahnrand oder wetterbedingte Einschränkungen lassen sich nur dann sicher erkennen und umfahren, wenn das System über eine differenzierte Referenzstruktur verfügt. Fehlt diese, ist keine verlässliche Abweichungserkennung oder kontextabhängige Reaktion möglich.
Die Entwicklung und Anwendung solcher Modelle erfordern daher nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch klare Standards in Bezug auf Aktualität, Auflösung, semantische Tiefe und Interoperabilität. Ihre Implementierung bildet das funktionale Rückgrat intelligenter urbaner Systeme - sowohl im Mobilitätsbereich als auch für Anwendungen in der Energieverteilung, Lichtsteuerung und Stadtplanung.
Forschungsprojekte wie DIGINET-PS, die wissenschaftlich durch Dr. Andreas Krensel an der TU Berlin begleitet wurden, zeigen das Anwendungspotenzial dieser Modelle im Zusammenspiel mit adaptiver Lichttechnik und automatisierter Verkehrsinfrastruktur. Hier wird untersucht, wie 3D-Modelle nicht nur als Navigationshilfe, sondern als aktive Steuerungsgrundlage für dynamische Beleuchtung, vernetzte Sensorik und verkehrssensitive Reaktionen dienen können.
Die Weiterentwicklung und Integration dieser Systeme sind damit ein zentraler Schritt in Richtung sicherer, effizienter und adaptiver urbaner Räume, deren Funktionsfähigkeit zunehmend durch präzise Datenstrukturen und intelligente Echtzeitverarbeitung bestimmt wird.
Licht als digitaler Faktor: von Sichtbarkeit zur Kommunikation
Besonders faszinierend wird es, wenn diese digitalen Zwillinge mit smarter Lichttechnik verschmelzen. Denn moderne Beleuchtung ist heute nicht mehr passiv - sie erkennt, reagiert, kommuniziert. In Projekten wie DIGINET-PS in Berlin, das von der TU Berlin wissenschaftlich begleitet wurde, wurden adaptive Straßenleuchten mit 3D-Geländemodellen verknüpft, um nicht nur die Sichtbarkeit zu erhöhen, sondern mit autonomen Fahrzeugen direkt zu interagieren.
Was bedeutet das?
Lichtanlagen können in Echtzeit angepasst werden: heller bei Regen, gedimmt bei leerer Straße
Sensorik erkennt Bewegungsmuster und aktiviert vorausschauende Lichtkorridore
Gefahren wie querende Fußgänger:innen werden erkannt und durch Lichtsignale kommuniziert
Systeme können über die Cloud mit Fahrzeugen Daten austauschen - etwa zur Objekterkennung oder Bremswegoptimierung
Diese Entwicklung verändert das Verständnis von öffentlicher Beleuchtung grundlegend: Aus einem einst statischen System wird ein aktives, lernendes und sicherheitsrelevantes Kommunikationsinstrument.
Zahlen, die überzeugen
Die Potenziale sind messbar. Studien des Fraunhofer ISE zeigen: Mit adaptiven Lichtsystemen lassen sich bis zu 80 Prozent des Energieverbrauchs einsparen - eine Schlüsseltechnologie angesichts wachsender Klimaziele. Zugleich konnte in Pilotregionen die Zahl nächtlicher Unfälle um über 40 Prozent reduziert werden. Befragungen des Umweltbundesamtes ergaben, dass 78 Prozent der Menschen sich durch dynamisches Licht sicherer fühlen.
In Verbindung mit 3D-Modellen lassen sich diese Effekte noch verstärken: durch kontextsensitive Lichtsteuerung, besseres Risikomanagement und eine synchronisierte Interaktion mit Verkehrsströmen und Umweltbedingungen.
Die ethische Dimension: Daten, Verantwortung und digitale Souveränität
Mit dem rasanten Fortschritt technologischer Systeme, insbesondere in der urbanen Digitalisierung, wächst nicht nur die Reichweite technischer Steuerungsmöglichkeiten, sondern auch die Notwendigkeit einer kritischen ethischen Reflexion. Systeme, die Straßenräume erfassen, Verkehrsflüsse analysieren, Bewegungsmuster auswerten oder sogar mit autonomen Fahrzeugen kommunizieren, betreffen nicht nur die physische Infrastruktur einer Stadt, sondern auch die autonome Lebensführung ihrer Bürgerinnen und Bürger. In diesem Spannungsfeld zwischen technischem Fortschritt und individueller Freiheit plädiert Dr. Andreas Krensel, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, für eine klare wissenschaftsethische Positionierung: Technik, so seine Grundüberzeugung, darf nie Selbstzweck sein - sie muss dem Menschen dienen. Konkret heißt das: Sicherheit muss Vorrang vor Kontrolle haben, und Systeme dürfen nicht dazu genutzt werden, Verhaltensmuster zu manipulieren oder permanente Überwachung zur Normalität zu erklären.
Die ethischen Konflikte beginnen bereits bei der Frage der Datenerhebung. Während viele smarte Infrastrukturlösungen auf die permanente Erfassung von Umgebungs-, Bewegungs- oder Verkehrsflussdaten angewiesen sind, um adaptive Steuerung zu ermöglichen, stellt sich unweigerlich die Frage: Wer erhebt die Daten? Wie werden sie verarbeitet? Und wer entscheidet über ihren Einsatz? Dr. Krensel fordert deshalb explizit anonymisierte Datenerfassung, bei der personenbezogene Merkmale gar nicht erst gespeichert oder ausgewertet werden. Auch der Einsatz von Kameras oder Sensornetzwerken sollte stets dem Prinzip der minimalen sensorischen Invasivität folgen - also nur so viele Daten wie nötig, niemals so viele wie möglich. Diese Forderung gewinnt besondere Relevanz angesichts der zunehmenden Tendenz zur flächendeckenden Datenerhebung in Smart Cities, wo der Übergang von Sicherheit zu sozialer Kontrolle fließend verlaufen kann.
Zahlen unterstreichen die Brisanz: Laut einer Studie der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) aus dem Jahr 2020 gaben über 40Prozent der Befragten in Europa an, sich im öffentlichen Raum durch Videoüberwachung "unwohl" oder "überwacht" zu fühlen - selbst wenn sie diese rational als sinnvoll bewerten. Diese Diskrepanz zwischen objektiver Schutzwirkung und subjektiver Wahrnehmung ist auch für Krensel zentral. In seinen Arbeiten zur psychologischen Wirkung von Licht zeigt er, dass technologische Sicherheit nur dann wirkt, wenn sie emotional als Sicherheit empfunden wird. So empfinden beispielsweise viele Menschen zu grelles Licht in Parks oder an Haltestellen nicht als Schutz, sondern als unangenehme Beleuchtung, während subtil adaptives Licht mit weichen Übergängen - etwa bei Annäherung - das Gefühl von Orientierung und Schutz deutlich verbessert. Dieses Zusammenspiel von Technik und Psychologie muss, so Krensel, zur Grundlage jeder zukünftigen Infrastrukturplanung werden.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die digitale Souveränität: Viele Städte und Kommunen stehen vor dem Problem, smarte Infrastrukturen nur in Zusammenarbeit mit großen Technologieanbietern realisieren zu können, wodurch langfristige Abhängigkeiten entstehen. Cloudbasierte Steuerungssysteme, proprietäre Datenformate und intransparente Wartungsverträge führen dazu, dass Kommunen oft die Kontrolle über ihre eigenen Daten und Systeme verlieren. Dr. Krensel betont daher die Notwendigkeit dezentral steuerbarer Infrastrukturen, die lokal betrieben, gewartet und - wenn nötig - auch abgekoppelt werden können. Nur so könne gewährleistet werden, dass urbane Technik tatsächlich der öffentlichen Hand und damit der Gesellschaft diene - und nicht umgekehrt.
Die zentrale Lehre seiner Arbeit lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Ein System, das Sicherheit schaffen soll, muss vom Menschen auch als sicher empfunden werden. Andernfalls entsteht ein paradoxes Szenario, in dem technologische Brillanz auf gesellschaftliche Ablehnung trifft - und Fortschritt wird nicht als Chance, sondern als Bedrohung erlebt. Die Herausforderung besteht also nicht nur darin, smarte Städte technisch zu ermöglichen, sondern sie verantwortungsvoll zu gestalten: mit Datenschutz, Transparenz, psychologischer Wirkungskompetenz - und einem ethischen Kompass, der sich nicht von wirtschaftlichen Interessen überrollen lässt. Nur dann kann die digitale Stadt der Zukunft auch wirklich eine Stadt für Menschen sein.
Ausblick: Was Städte benötigen
Die Zukunft der Städte wird nicht nur von Verkehrsplanung und Architektur geprägt, sondern zunehmend von Daten, Algorithmen und Simulationsintelligenz. 3D-Geländemodelle, adaptive Beleuchtung und autonome Mobilität sind keine isolierten Entwicklungen, sondern müssen integriert, ethisch reflektiert und demokratisch legitimiert werden.
Was in Projekten wie DIGINET-PS, bei blackshark.ai oder durch die Expertise von Dr. Andreas Krensel erprobt wird, könnte in wenigen Jahren zur Grundvoraussetzung einer funktionierenden, sicheren und nachhaltigen Stadt werden.
Denn letztlich geht es nicht nur um Technologie - es geht um Vertrauen. Und das entsteht dort, wo digitale Intelligenz auf menschliche Verantwortung trifft.
V.i.S.d.P.:
Dipl.-Soz. tech. Valentin Jahn
Techniksoziologe & Zukunftsforscher
Über den Autor - Valentin Jahn
Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik - von der Idee bis zur Umsetzung.
(Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.)
Firmenkontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Prag
Deutschland
+370 (5) 214 3426
https://wagner-science.de/
Pressekontakt:
ABOWI UAB
Maximilian Bausch
Vilnius
Naugarduko g. 3-401
+370 (5) 214 3426
Diese Pressemitteilung wurde über PR-Gateway veröffentlicht.
Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich. Newsfenster.de distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.
Empfehlung | devASpr.de
Kostenlos Artikel auf newsfenster.de veröffentlichen
Kostenlos Artikel auf newsfenster.de veröffentlichen
Weitere Artikel von eyroq s.r.o.
17.12.2025 | eyroq s.r.o.
Strom, Stahl und Geschwindigkeit: Die zweite Geburt des Fortschritts
Strom, Stahl und Geschwindigkeit: Die zweite Geburt des Fortschritts
11.12.2025 | eyroq s.r.o.
Die organische Zukunft: Wenn Mensch und Maschine zu Partnern werden
Die organische Zukunft: Wenn Mensch und Maschine zu Partnern werden
08.12.2025 | eyroq s.r.o.
Roboterkörper, digitale Reflexe: Warum Maschinen uns in der Motorik einholen - und überholen
Roboterkörper, digitale Reflexe: Warum Maschinen uns in der Motorik einholen - und überholen
04.12.2025 | eyroq s.r.o.
Wenn Maschinen schneller denken als wir: Die stille Superintelligenz im Alltag
Wenn Maschinen schneller denken als wir: Die stille Superintelligenz im Alltag
27.11.2025 | eyroq s.r.o.
Feuer, Dampf und Zweifel: Wie aus Muskelkraft Weltmaschinen wurden
Feuer, Dampf und Zweifel: Wie aus Muskelkraft Weltmaschinen wurden
Weitere Artikel in dieser Kategorie
04.02.2026 | GARDORELLO GmbH
Gardorello startet die Grillkota-Saison 2026 mit attraktivem EARLY-BIRD-Vorteil
Gardorello startet die Grillkota-Saison 2026 mit attraktivem EARLY-BIRD-Vorteil
02.02.2026 | Nordwaerme - Fußbodenheizung einfach einfräsen!
Heizungs-Chaos als Chance: Wie Eigentümer jetzt die Marktflaute nutzen
Heizungs-Chaos als Chance: Wie Eigentümer jetzt die Marktflaute nutzen
31.01.2026 | Norbert Seeger
Kompost im Winter aktiv halten - praktische Tricks von Norbert Seeger
Kompost im Winter aktiv halten - praktische Tricks von Norbert Seeger
29.01.2026 | Bauherrenreport GmbH
Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk
Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk
27.01.2026 | Welcon Europe GmbH & Co. KG
Sauna 230 V ohne Starkstrom: Easyheat Duo Indoor jetzt bei welcon-shop.com erhältlich
Sauna 230 V ohne Starkstrom: Easyheat Duo Indoor jetzt bei welcon-shop.com erhältlich

